AKUTES:
Mittwoch, 7. Juni 2006
Montag, 5. Juni 2006
3 Kritiken am "Gründungsaufruf für eine neue Linke"
Mittwoch, 17. Mai 2006
Alarm:
Korallen vor dem Overkill
Klimaerwärmung führt zum Ende der Riffe
| |||
Newcastle/Washington - Die Zukunft für die Korallenriffe sieht nicht gerade rosig aus. Ein Forscherteam der University of Newcastle http://www.ncl.ac.uk hat nun weitere Details der riffbildenden Tierkolonien entdeckt. Einmal zerstörte Korallenriffe erholen sich schlechter als bisher angenommen. Zudem kommt noch ein massives Artensterben von Fischen sowie vermehrtes Algenwachstum, berichten sie in der jüngsten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Proceedings of the National Academy of Sciences http://www.pnas.org .
Das Forscherteam um Nick Graham hat ein Riff vor den Seychellen untersucht. Dort war 1998 nach einer Erwärmung des Meeres ein Großteil der Korallen abgestorben. Nach ersten Schätzungen waren fast 90 Prozent aller Korallen in der Region um die Inselgruppe schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die gefürchtete Korallenbleiche gilt als unmittelbare Folge der Ozeanerwärmung, wie Experten dies mehrmals berichtet haben. "Die Korallenbleiche tritt häufiger auf. Nach Vorhersagen wird sich diese Situation in den kommenden Jahren weiter verschärfen", so Graham.
Korallen leben mit den photosynthetisch lebenden Algen in einer Symbiose. Wenn allerdings die Temperatur des Meerwassers steigt, geraten die Korallen unter Stress und stoßen die Algen ab. Forscher vermuten, dass die Algen unter den veränderten Temperaturen Toxine produzieren. Die Algen sind für das Überleben der Korallen lebensnotwendig. Sie sind es auch, die den Korallen ihre Farbe verleihen. Wenn die warmen Temperaturen anhalten, sterben die Korallen in Massen ab und verlieren ihre Farbe.
Das Jahr 1998 ist als "Katastrophenjahr" für die weltweiten Riffe in die Geschichte eingegangen. 16 Prozent aller Korallen sind allein in diesem Jahr abgestorben. Der westliche Indik war am härtesten betroffen, da es hier zu einer Interaktion zwischen dem El Nino und dem auf den Indischen Ozean beschränkten Ozean-Atmosphären-System (Dipol-Modus) gekommen war. Während der vergangenen sieben Jahre haben sich vieler dieser Riffe nicht mehr erholt, sondern sind zu einem riesigen Korallenfriedhof geworden, der mit dicken Algenschichten überzogen ist. Dieser Kollaps habe dazu geführt, dass der Schutz- und Nahrungseffekt eines intakten Riffsystems für zahlreiche andere Lebewesen weggefallen ist. In der untersuchten Region waren vier Fischspezies überhaupt völlig verschwunden, sechs andere waren nur in sehr geringer Häufigkeit vorhanden. Generell hat die Diversität von Fisch-Spezies in den untersuchten Riffen um 50 Prozent abgenommen.
Reduzierte Biodiversität macht ein Korallenriff zu einem fragilen und nicht stabilen Ökosystem. Nach Aussagen der Forscher hat auch die Zahl der kleinen Fische rapide abgenommen. Am schlimmsten beurteilen die Wissenschaftler das Verschwinden der pflanzenfressenden Fische. Diese spielen gerade bei der Reduzierung der Algenbewüchse eine wichtige Rolle. Das untersuchte Riff, das weit abgelegen von anderen Riffen lag, war aufgrund der Isolation besonders beeinträchtigt. In geschlossenen Systemen wie etwa dem Great Barriere Reef in Nordost-Australien gebe es einen besseren Schutz. Hier könne es rascher zu einer Neuansiedlung kommen, meinen Experten.
Seit 1998 hat es im Indischen Ozean mindestens drei weitere massive Erwärmungen gegeben, im Pazifik mindestens zwei. "Verschiedene Computer Simulationen haben gezeigt, dass solche Massenbleichungen in Zukunft einmal jährlich stattfinden könnten. Daran kann man sich ausrechnen, wie es um den Fortbestand der Korallenriffe steht", meint Graham. Weltweit existieren etwa 285.000 Quadratkilometer Korallenriffe. In diesen lebt rund ein Viertel alle marinen Lebewesen.
Donnerstag, 11. Mai 2006
Aufruf zur Demonstration 03.06.2006

Die deutschen Regierungen sind seit Jahren die Motoren in Europa, die Massenentlassungen, Verarmung, Abbau sozialer Grundrechte, Arbeitnehmerrechte zugunsten der Profitinteressen der europäischen Konzerne vorantreiben.
Sei es die Verabschiedung des "Stabilitäts- und Wachstumspaktes" (Lissabon 2000) auf europäischer Ebene, oder sei es die Verabschiedung der "Agenda 2010" mit den Hartz-Gesetzen auf nationaler Ebene: Überall wird das Ziel verfolgt, den größten Sozialabbau seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs durchzuführen.
In Deutschland ...
Weiter - dort - in dritter Zeile unter dem Foto
Dienstag, 2. Mai 2006
Auf verdächtige E-Mails hin keine Daten per Telefon herausgeben
Das Telefonat nimmt dabei ein Sprachcomputer entgegen, über den Betrüger beispielsweise Bankdaten abfragen, erklärt Andreas Marx vom Unternehmen AV-Test in Magdeburg. «Banken würden so etwas nie per Mail fordern», warnt der Wirtschaftsinformatiker, der in Zusammenarbeit mit der Universität Magdeburg Virenschutz-Software testet.
«Das Phishing per Telefon ist nur die neue Variante eines bekannten Tricks», erklärt Marx. Generell sollten Internetnutzer niemals Kreditkartennummern oder Passwörter auf eine E-Mail hin herausgeben. «Im Zweifelsfall ruft man besser seine Bank unter einer Nummer an, die in den eigenen Unterlagen steht, und fragt nach.» Ebenso wie Banken bittet zum Beispiel auch eBay seine Mitglieder nach eigenen Angaben nicht per E-Mail um die Eingabe vertraulicher Daten.
Phishing beschreibt den Diebstahl und Missbrauch vertraulicher Daten. Beim «herkömmlichen» Phishing führt der Link aus einer E-Mail mit gefälschtem Absender auf eine betrügerische Webseite zur Datenabfrage. Klicken verboten gilt auch, wenn die Mail angeblich von einem Hersteller von Virenschutzprogrammen kommt. In diesem Fall könnte der Klick zum Beispiel die wichtige Aktualisierungsfunktion der Software ausschalten, warnt Marx.
Phishing-E-Mails sind oft entweder an unrealistischen Versprechen oder der Mahnung zu großer Eile zu erkennen. «Sobald ich eine Mail bekomme, die schnelles Geld verspricht oder den Verlust eines Kontos androht, sollte ich skeptisch werden», sagt Andreas Marx. Oft stellen sich die Phisher auch selbst ein Bein: «Eine deutsche Bank schreibt nicht auf Englisch und garantiert ohne Formulierungs- und Rechtschreibfehler.»
Mittwoch, 26. April 2006
WASG Sachsen konsequent antifaschistisch und antirassistisch - kein Platz für Rechtsradikale!
anbei eine Presseerklärung der WASG-Sachsen zum Vorfall um Andreas Wagner.
mit solidarischem GRuß
Johannes Gyarmati
>Der Landesvorstand der WASG Sachsen erklärt zur Tätigkeit Andreas Wagners für die NPD-Fraktion im Landtag:
>
>Andreas Wagner, WASG-Mitglied im Landesverband Sachsen, soll laut Sächsischer Zeitung als Sozialreferent in der Landtagsfraktion der NPD in Sachsen eingestellt werden. Mittlerweile ist dies vonseiten der rechtsextremen NPD und dem Umfeld ihrer Fraktion bestätigt worden. Der Landesverband der WASG Sachsen hat seit mehr als einem halben Jahr keinen Kontakt zu Wagner.
>
>Die WASG steht mit ihrem politischen Anliegen für eine freie und sozial gerechte Gesellschaft, in der die Würde jedes Menschen geschützt und geachtet ist, unabhängig von seiner Herkunft. Deshalb stehen wir für konsequenten Antifaschismus und Antirassismus.
>
>Die WASG Sachsen bietet Personen, die mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache machen oder deren Gedankengut vertreten keinen Platz. Der Landesvorstand hat heute einen Eilantrag an das Bundesschiedsgericht gestellt, Wagner aus der >Partei auszuschließen und bis zur Entscheidung jegliche Mitgliedsrechte ruhen zu lassen.
>
>
>Enrico Stange
>Pressesprecher
>0163-1623219
Freitag, 21. April 2006
Hartz IV: Bald Kontrollen wie beim Zoll?
Donaukurier
Berlin (DK) Die große Koalition will rund fünf Prozent der Kosten für Langzeitarbeitslose durch verstärkte Missbrauchsbekämpfung einsparen. Das"Optimierungs- gesetz" zu Hartz IV, an dem die Arbeitsmarktexperten derzeit tüfteln, soll die Kasse des Bundes um jährlich 1,2 Milliarden Euro entlasten: "Diejenigen, die Leistungen beanspruchen, sollen ohne zeitliche Verzögerung Angebote von Trainingsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten oder
konkreten Stellen bekommen", erklärt der Arbeitsmarkt- politische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Klaus Brandner.
Sofortangebote um die Arbeitswilligkeit zu prüfen, Telefonabfragen mit Auskunftspflicht und Kontrolleure für Hausbesuche zählen zu den vorgesehenen Instrumenten, um die eingeplanten Kosten von allein 24,4 Milliarden Euro in
diesem Jahr abzusenken. "Überprüfung wird eine wichtige Rolle spielen", bestätigte Max Straubinger (CSU), der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der CSU-Landes- gruppe, gestern gegenüber unserer Berliner Redaktion. Bereits im Mai soll ein Gesetzentwurf vorliegen.
Im Koalitionsvertrag waren drei konkrete Instrumente formuliert worden. So sollen Langzeitarbeitslose "zur Teilnahme an einer Telefonabfrage verpflichtet werden, in der die aktuellen Lebenssituationen überprüft werden." Eine erste – noch freiwillige – Telefonumfrage bei 340 000
Arbeitslosengeld-II-Empfängern im vergangenen Jahr war ernüchternd ausgefallen: Rund die Hälfte war trotz mehrfacher Versuche (drei Anrufe zu verschiedenen Zeiten laut Bundesagentur) nicht erreichbar gewesen. Immerhin
15 000 wurden aus dem Leistungsbezug gestrichen, weil sie erklärt hatten, inzwischen Arbeit zu haben. Seit Januar läuft die zweite Runde der Telefonaktion, auch diesmal mit unbefriedigenden Ergebnissen: Ungefähr jeder dritte Leistungsempfänger ist nicht erreichbar oder will keine Auskunft geben, bestätigt die Bundesagentur. Union und SPD setzen nun auf die gesetzliche Verpflichtung zur Auskunft, um schwarzen Schafen schneller auf die Schliche zu kommen.
Der Versuch, die Kontrolleure per Telefon mit falschen Angaben auszutricksen, soll ebenfalls erschwert werden. Gemeinsam mit den Ländern wird geprüft, so heißt es im Koalitionsvertrag, "ob die Einrichtung eines Außendienstes bei den Arbeitsgemeinschaften und den zugelassenen kommunalen Trägern vorgesehen werden soll". Hartz-IV-Kontrolleure könnten dann zum Hausbesuch erscheinen, ähnlich wie Sondereinheiten des Zolls gegen Schmuggel und Schwarzarbeit vorgehen.
Am meisten verspricht sich die Koalition jedoch von einer scheinbar ganz simplen Maßnahme: "Sofortangebote zur Aufnahme einer Beschäftigung oder Qualifizierung." Weiter heißt es im Koalitionsvertrag: "Diese Maßnahmen können auch der Überprüfung der Arbeitswilligkeit dienen." Daran wird deutlich: Um Traumjobs geht es hier nicht, sondern in erster Linie darum, wenigstens eine Gelegenheit zum Hinzuverdienen anzubieten wie Ein-Euro-Jobs oder die Vermittlung als Erntehelfer statt ausländischer Saison- arbeiter. Wer kneift, müsste mit Sanktionen rechnen, also Kürzungen des Arbeitslosengeldes II.
"Die Frage ist, ob man überall direkt ein Arbeitsangebot unterbreiten kann", räumt CSU-Arbeitsmarktexperte Straubinger ein. Schließlich herrsche "in Gegenden mit um die 20 Prozent Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern oder
Gelsenkirchen" nun einmal akuter Mangel an Arbeitsplätzen. Da müsse man davon ausgehen, dass es in aller Regel an Arbeitsgelegenheit fehlt, nicht am Willen zu Arbeiten
Quelle:
www.donaukurier.de
Mittwoch, 5. April 2006
Mißbrauch zustimmen?
da ich kurze Zeit vom Landesrat gewählter Delegierter des Länderrats für NRW sein
konnte, interessiere ich mich für die Arbeit des Länderrats. Dabei bin ich auf
folgenden Protokolltext gestossen: (aus Protokoll Länderrat v. 5.03.06 in
Frankenthal, gefunden auf Homepage der WASG Oberhausen unter:
http://www.b-heydthausen.homepage.t-online.de/BH_Dateien/laenderrat_protokoll_050306.pdf
"....Initiativantrages Absatz 2: Urabstimmung darf nicht zur Ausgrenzung missbraucht
werdenAbstimmung Ja: 18 Nein: 20 Enthaltung: 0Abgelehnt...."Mal ganz langsam: eine
knappe Mehrheit der Delegierten des Länderrats hat es abgelehnt, einem Antrag
zuzustimmen, der einen Mißbrauch der Urabstimmung zur Ausgrenzung ausschliessen
will.
Wie soll mensch das verstehen? Das ist absurd. Die Mehrheit der Delegierten der
WASG bundesweit ist für den Mißbrauch der Urabstimmung als Instrument der
Ausgrenzung!Unglaublich.
Sonntag, 2. April 2006
AKUTES:
"Vielen Dank" noch für den sehr schönen Start den wir zusammen hingelagt haben!
112 Einträge von 24 User innerhalb eines Wochenende - das ist schon was.
Nochmals meine E-Mail-Adresse:
wahlalternative@ostmail.de
(anstelle eines Gästebuches, das allerdings nur nicht da ist, weil ich es noch nicht zuordnen konnte)
"Viele Grüße" wega
Freitag, 31. März 2006
Spamlisten: Freud und Leid für geblockte Nutzer
Wien/Mainz (pte/31.03.2006/13:59) - Spamfilter und Spamlisten gehören mittlerweile zur Grundausstattung, um einen effizienten Mailverkehr im eingenen Betrieb zu gewährleisten. Unternehmen, die ihren Kundenkontakt per Newsletter aufrechterhalten, kommen dadurch jedoch immer öfter in Gefahr, dass sich diese mittlerweile notwendigen Filterinstrumente auch gegen sie selbst richten. "Spam ist gerade für Unternehmen, die auf E-Mail-Marketing setzen, ein komplexes und kompliziertes Thema, denn bald jedes Land hat andere Bestimmungen und es gibt keinen allgemeingültigen Standard, nach welchem die unterschiedlichen Anti-Spam-Plattformen vorgehen", meint Igor Schellander, Leiter Direct Marketing beim Internetserviceprovider (ISP) Inode http://www.inode.at , gegenüber pressetext.
Landet man dennoch auf einer Blocklist, so kann es zu einem beschwerlichen Weg werden, hiervon wieder gelöscht zu werden. "Zuerst muss man seine Absichten offen legen um zu beweisen, dass man kein Spammer ist. Meistens wird man auch nicht herum kommen, den Handelsregistereintrag vorzulegen, um sich als seriöses Unternehmen zu qualifizieren", erklärt Christoph Hardy, Sicherheitsexperte bei Sophos http://www.sophos.com . "Diese Prozedur kann lange dauern", bestätigt auch Schellander. Darunter leiden auch die Kunden, die auf die geblockten Informationen, beispielsweise ein Newsletter, warten. "Als ISP können wir unseren Kunden hier mit Rat und Tat zur Seite stehen, die Überzeugungsarbeit muss jedoch von den betroffenen Unternehmen selbst geleistet werden. Plattformen wie Spamcop und Spamhaus sind unabhängige Organisationen und gegenüber niemandem weisungsgebunden."
Die Betreiber der Listen reagieren durchaus langsam bei der Bearbeitung von Beschwerden und lassen sich nur mühsam davon überzeugen, dass über einen Server keine beziehungsweise unabsichtlich "unerwünschte" Mails verschickt wurden. "Wir arbeiten nach strengen Kriterien", verteidigt sich Steven Linford, Sprecher The Spamhaus Project http://www.spamhaus.org , auf Anfrage von pressetext. Dass man unabsichtlich auf die Liste gelangen kann, weist Linford zurück: "Wer nur E-Mails verschickt, deren Empfänger nach der "Closed-Loop Opt-In"-Methode verifiziert wurden, wird niemals auf unsere Liste kommen". Close Loop Opt In bedeutet, dass der Empfänger ausdrücklich und nachvollziehbar seine Zustimmung zur Aufnahme auf eine Mailinglist gegeben hat http://www.spamhaus.org/mailinglists.html .
Ein striktes Opt-In-Verfahren fordert auch der österreichische Gesetzgeber seit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) (pte berichtete: http://www.pte.at/pte.mc?pte=060228030 ). Jedoch wurden diese Vorgaben erst von wenigen Online-Medien umgesetzt.
Bei Spamlisten wird zwischen Allow- und Blocklists unterschieden. Wird eine Blocklist zur Filterung genutzt, so werden E-Mails von Servern, die in der Datenbank gelistet sind, geblockt. In der Allowlist werden Absender angeführt, die per se vertrauenswürdig sind. Diese Blocklisten werden laufend aktualisiert und erkennen Spam-Mails nach bestimmten Kriterien. "Es gibt bei den meisten Spamlisten über 800 verschiedene Regeln, wonach zwischen Spam und sauberen Mails unterschieden wird", erklärt Hardy.
Ein Kriterium sind beispielsweise so genannte "Dirty Words". "Kommt in einem Mail das Wort Viagra vor, eventuell auch noch in Verbindung mit einer Zahl, so kann schon ein Spamverdacht vorliegen. Ein anderes Kriterium ist, dass viele identische Mails gleichzeitig verschickt werden. Die IP-Adressen dieser Server werden dann genauer beobachtet und wenn sich die Verdachtsmomente häufen, werden die Server geblockt", so Hardy.
An öffentliche Listen wie Spamcop http://www.spamcop.org kann zudem jede Privatperson E-Mails melden, von denen sie sich belästigt fühlt. "Langt dort eine bestimmte Anzahl derselben E-Mail ein, wird Spamcop tätig", erklärt Schellander. "Ein Newsletter kommt natürlich leicht in die Gefahr, diese Kriterien zu erfüllen. Daher müssen Unternehmen, die sich per E-Mail an ihre Kunden wenden, dabei vorsichtig agieren", empfiehlt Hardy. Auf der sicheren und seriösen Seite befinde sich ein Unternehmen, das seine digitalen Informationen nur als reinen Text verschickt. "Am besten ist ein plain-text-Format ohne Attachements. Zudem sollten die Nachrichten keine aktiven Links enthalten und optimalerweise individualisiert sein", so der Experte.
Eine zusätzliche Hilfe für Geschäftskunden kann die sogenannte White- oder Allowlist sein. "Die österreichischen ISPs führen Listen von vertrauenswürdigen Unternehmen, die sie auch miteinander abgleichen. Damit können wir sicherstellen, dass Newsletter dieser Kunden nicht vom System gefiltert werden. Um auf diese Listen zu kommen müssen jedoch strenge Kriterien erfüllt werden", so Schellander.
Problematisch sieht Hardy die Öffentlichkeit mancher Listen. Zwar steht die Absicht dahinter, dass die IP-Adressen dieser Spamversand-Server für jedermann ersichtlich und somit bekämpfbar sind. "Die Versender von Spam wissen das jedoch ebenso und können darauf reagieren, indem sie einen anderen Server benutzen", so Hardy abschließend gegenüber pressetext. (Ende)
Aussender: pressetext.austria
Redakteur: Andreas List
email: list@pressetext.com
Tel. ++43-1-81140-313
© pressetext.deutschland +++ pressetext.austria +++ pressetext.schweiz +++ termindienst +++ fotodienst +++ newsfox.com oder der jeweilige Aussender
Änderung Abo
Medieninhaber und Herausgeber:
pressetext Nachrichtenagentur GmbH, Josefstädter Straße 44, A-1080 Wien
pressetext ist eine Nachrichtenagentur für Meinungsbildner in den Bereichen Hightech, Medien, Business und Leben. Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für über pressetext verbreitete Presseaussendungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Die Nachrichten werden auf den pressetext-Länderplattformen von http://www.pressetext.com publiziert sowie den Abonnement-Wünschen und der gewählten Zustellart entsprechend einzeln oder täglich als Newsletter (pressetext.digest) an die Abonnenten verschickt. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter Tel. +43-1-81140-300.












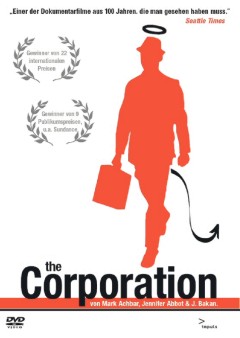

 Till Müller-Heidelberg/ Ulrich Finckh/ Rolf Gössner u.a. (Hg.):
Till Müller-Heidelberg/ Ulrich Finckh/ Rolf Gössner u.a. (Hg.):
 Hausbesuche
Hausbesuche
